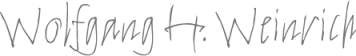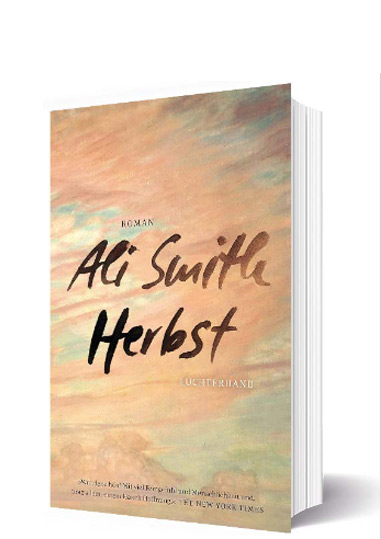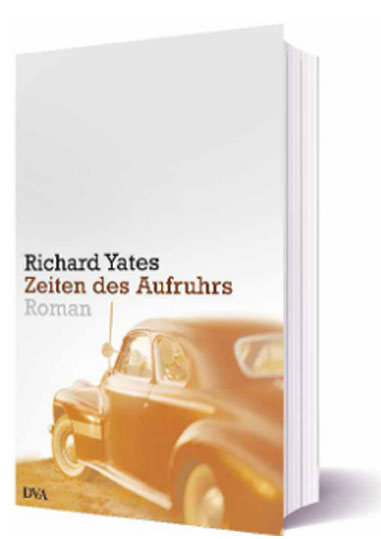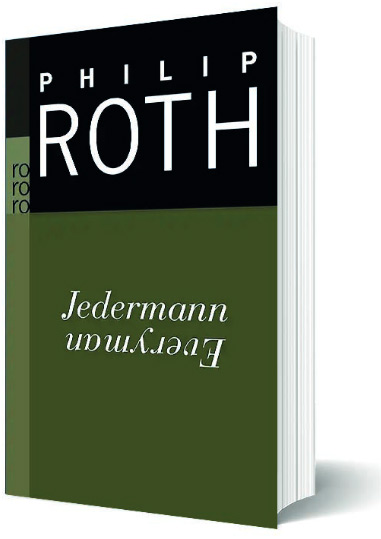Ali Smith – Herbst
Dieses Buch von Ali Smith sträubt sich gegen jede einfache Einordnung. Als Auftakt zu ihrem Jahreszeiten-Quartett begibt sich die britische Autorin hier auf experimentelles Terrain, indem sie das Politische mit dem Persönlichen, den Traum mit der Wirklichkeit, die Vergangenheit mit der Gegenwart verwebt.
Claire Lynch – Familiensache
Maggie ist Mitte vierzig, hat zwei Kinder im Teenageralter, einen netten Mann und ihren Vater Henry, genannt Heron, mit dem sie sich schon immer gut verstanden hat. Zum Glück, denn nachdem sie in Maggies frühester Kindheit von ihrer Mutter Dawn verlassen wurden, hatten sie nur einander. Nun jedoch ist Heron krank, Krebs, unheilbar, und mit der ihm eigenen Pragmatik macht er sich daran, seine Dinge in Ordnung zu bringen: das Haus aufzuräumen, die Unterlagen zu sortieren, wegzuschmeißen, was nicht mehr gebraucht wird.
Maggie, auch sie pragmatisch, hilft ihm dabei – und stößt auf gerichtliche Unterlagen, die das Verschwinden ihrer Mutter in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Ist es etwa gar nicht Dawns Wunsch gewesen, ihre Tochter nicht mehr zu sehen? Und wie kommt es, dass sich zahllose Briefe und Geschenke von ihr finden, die Maggie nie erreicht haben? Je mehr Maggie nachforscht, desto klarer wird ihr: Nicht ihre Mutter wollte den Kontakt zu ihr abbrechen, sondern die Gerichte untersagten ihn ihr. Als zu schädlich schätzten sie den Umstand ein, dass Dawn sich in eine Frau verliebt hatte und mit dieser zusammenlebte.
Elizabeth Strouts – Mit Blick aufs Meer
Elizabeth Strouts Oeuvre umfasst zehn Bücher, von denen die meisten Bestseller sind. Die 69-jährige Amerikanerin stammt aus Maine. Und ebendort – im fiktiven Küstenstädtchen Crosby – spielt eines ihrer besten Bücher. Es heißt „Mit Blick aufs Meer“ und hat nach dem Erscheinen 2008 den Pulitzer-Preis erhalten.
Im Original heißt das Buch „Olive Kitteridge“, und das macht Sinn, denn besagte Olive Kitteridge ist die Hauptfigur des Romans. Die ehemalige Mathelehrerin ist so harsch, undiplomatisch und schnell erzürnt wie klug, empathisch und verletzlich. Tatsächlich ist Olive hinter ihrer ruppigen Fassade eine ziemlich anständige Person fernab jeder Scheinheiligkeit. Wie es Strout gelingt, sie in ihrer Widersprüchlichkeit zu zeichnen, ist hohe Kunst. Und das gilt auch für die anderen Figuren des Romans.
Richard Yates – Zeiten des Aufruhrs
Als 1961 Revolutionary Road erschien – so der Originaltitel des Romans –, war sein Autor Richard Yates bereits Mitte dreißig. Bis dahin war er lediglich durch einige Erzählungen aufgefallen. Der Roman wurde ein Erfolg – und sollte doch fast sein einziger bleiben. Zwar wurde Yates von Kolleginnen und Kollegen hoch geschätzt, doch beim breiten Publikum blieb er zeitlebens ein Geheimtipp.
Ein Grund dafür lag wohl in der Wahl seiner Charaktere: In seinen sechs Romanen und drei Erzählbänden richtet Yates den Blick vor allem auf die ordinary people, auf die ganz normalen Menschen.
„Sie rennen alle umher und versuchen, ihr Bestes zu geben – sie versuchen, innerhalb ihrer bekannten oder unbekannten Grenzen gut zu leben, sie tun, was sie nicht lassen können, und scheitern letztlich und unvermeidlich, weil sie nicht anders können, als die Menschen zu sein, die sie sind. Das ist es, was am Ende das Unglück herbeiführt,“ sagte Yates in einem Interview im Jahr 1971.
Nina Bussmann: Drei Wochen im August
Drei Wochen im August ist der vierte Roman der Autorin Nina Bußmann. Bußmann, 1980 in Frankfurt am Main geboren, wurde von Anfang an für ihr ebenso kunstvolles wie psychologisch genaues Schreiben hochgelobt. Leicht machte sie es ihren Leserinnen und Lesern allerdings nie:
Ob in ihrem ersten Roman – Große Ferien –, in dem ein Lehrer und ein Schüler in einen Skandal verwickelt sind, dessen Inhalt bis zum Schluss nicht ganz klar wird, oder in ihrem Roman Dickicht, wo sie drei Menschen auf ihrer Sinnsuche zwischen Abhängigkeit und Freundschaft, Therapieversprechen und spirituellen Verlockungen folgt: leichte Kost waren ihre stilistisch anspruchsvollen Bücher nie. Wohl auch deshalb war sie lange so etwas wie ein Geheimtipp. Mit Drei Wochen im August hat sich dies zumindest geändert: das Buch ist zugänglicher als die anderen, der Stil knapper und weniger mäandernd, die mediale Aufmerksamkeit groß. Dass dieser Roman bei aller Zugänglichkeit literarisch überzeugend ist, ist für die Leserschaft ein Glück – und dem Können einer Autorin geschuldet, die zu entdecken sich lohnt.
Doris Lessing: Das fünfte Kind
Im Oktober 2007 ging ein Foto um die Welt: Eine weißhaarige Frau in Jeansrock und Karohemd ist darauf zu sehen, wie sie auf der Treppe eines Londoner Backsteinhauses sitzt.
Im Arm hält sie zwei Blumensträuße und einen Briefumschlag. Die Frau ist die Schriftstellerin Doris Lessing und sie sieht auf dem Foto erstaunt aus und überfordert. Doris Lessing war einkaufen gewesen, als die Schwedische Akademie ihre Entscheidung verkündete. Erst als sie zwei Stunden später vom Einkaufen zurückkam, erfuhr sie von den versammelten Reportern, dass sie den Nobelpreis bekommen würde.
Ihr Roman „Das fünfte Kind“ kommt, verglichen damit, weniger spektakulär daher – und doch finde ich dieses Buch ihr interessantestes. Die erste Idee zu dem Roman, erklärte Doris Lessing in einem Interview, sei aus ihrer „Faszination für das kleine Volk“ entstanden: „Jedes Land der Welt kennt Sagen über die kleinen Leute, und ich habe so die Vermutung, dass sie wahrscheinlich wirklich existiert haben.“
Elazar Benyoëtz: Brüderlichkeit
Mit Elazar Benyoëtz möchte ich Ihnen heute einen Dichter vorstellen, der vielen als der bedeutendste deutschsprachige Aphoristiker der Gegenwart gilt.
Zum ersten Mal begegnet bin ich ihm und seinem Werk vor mehr als fünfundzwanzig Jahren. Ich war Doktorandin in Bern, und Elazar Benyoëtz trat dort mit einer Lesung auf. Als ein bereits damals weißhaariger, weißbärtiger Mann strahlte er die Würde des Rabbiners aus, zu dem er bereits in jungen Jahren ordiniert worden war – seine klugen, genau beobachtenden Aphorismen unterstützten diesen Eindruck.
Als wir uns im Anschluss an die Lesung vorgestellt wurden, richtete Benyoëtz sein Augenmerk nicht etwa auf sich selbst als der Hauptperson, sondern auf mich und meine gerade beendete Forschungsarbeit, die er sich nach Jerusalem schicken ließ, um mir bald darauf ausgesprochen erhellende Anmerkungen dazu zu schreiben.
Ich erzähle das, weil ich glaube, dass das typisch für ihn und damit auch für seine Literatur ist: die Welt um sich mit wachem Geist aufzunehmen und dem Anderen, dem Fremden mit uneitlem Interesse zu begegnen.
Christopher Coake: Bis an das Ende der Nacht
Christopher Coake schreibt Kurzgeschichten. Coake, der 1971 in Indiana geboren wurde und in Reno an der Universität unterrichtet, ist ein Meister der Anfänge. Mit dem ersten Satz lockt er die Leserin, den Leser in seine Geschichten wie die Maus in die Falle: „Albert ist neunundsiebzig, und er stirbt.“ Darüber der Titel der Erzählung: „Der glücklichste Mensch“ - ein Titel, der plötzlich fast anstößig, gleichzeitig schrecklich traurig wirkt. Und Coake ist ein Meister des offenen Endes: Lakonisch wie die Auftakte der Erzählungen sind seine Schlusssätze, Sätze, die nichts abschließen, nichts zu einem Ende bringen. Das letzte Wort in Coakes Geschichten haben ohnehin meist seine Figuren.
Genau das ist symptomatisch für die sieben Erzählungen, die in Christopher Coakes Debüt „Bis an das Ende der Nacht“ (2005) versammelt sind: Sie fokussieren den Menschen, beobachten genau, beschreiben ihn in existenziellen Situationen. Fast scheint es, als sei Coake dem Diktum des eingangs schon erwähnten Ford gefolgt, der einmal sagte, er begnüge sich damit, über die „wichtigsten Dinge zu schreiben“: darüber, „wie die Menschen sich zu retten versuchen, wie man seine Liebe zum Leben aufrechterhalten kann, wie man seine Geschichte überlebt“.
Ursula Fricker: Gesund genug
Als ich Ursula Frickers Buch „Gesund genug“ in die Hand nahm, war ich also, nach drei Jahren in Kalifornien, vorbereitet – auch wenn es in Frickers Roman nochmals deutlich extremer zugeht.
Die 1965 in Schaffhausen geborene Autorin nimmt uns mit in eine Schweizer Familie (ihre Familie; dass das Buch autobiographische Züge trägt, gibt sie freimütig zu), die schon lange, bevor es Mainstream wurde, die fleischlose, vollwertige Ernährung verfolgt. Angetrieben durch den Vater, für den die Gesundheit der Familie das oberste Lebensziel ist.
Alles beginnt mit dem Buch „Sonnseitig leben“ des Schweizer Bildhauers und Gesundheitspioniers Rudolf Müller. Das Buch wird für den Vater zur Bibel:
„Alles, was man bisher gemocht und genossen hatte, war in Wahrheit Gift. Schinken und Weißbrot, Schokolade, Gipfeli, Sonntagsbraten, Spaghetti, weißer Reis, Kaffee, Kuchen, Alkohol und Tabak sowieso. Aber leider war nicht nur die landläufige Nahrung vergiftet, sondern auch die Luft. All die Wände und Teppiche mit ihren Ausdünstungen, ganz zu schweigen vom Zigarettenqualm, von den Abgasen der Autos und Fabriken. Alle Welt wollte Alwin Tobler vergiften (…). Lösung? Verzichten. Auf alles. Für die Umwelt, für die Gesundheit. Für ein ewig langes Leben.“
Hellen Hodgman: Gleichbleibend schön
Vor einigen Jahren hatte ich ein Manuskript fertig, für das mein Agent einen neuen Verlag suchte. Zwei Verlage hatten Interesse – und weil mir beide gut gefielen und die Offerten auch ungefähr die gleichen waren, entschied ich mich, das zu tun, was ich am liebsten tue: zu lesen. Zu diesem Zweck ließ ich mir von beiden Verlagen eine Auswahl von Büchern schicken. Eines davon war der Roman „Gleichbleibend schön“ („Blue Skies“ im Original) der Autorin Helen Hodgman.
Von der Autorin gehört hatte ich noch nie, und damit war ich wohl nicht alleine. Denn obwohl Hodgman 1979 den renommierten Somerset Maugham Literaturpreis gewonnen hatte – für ihren Zweitling „Jack and Jill“, eigentlich aber, so glaube ich, verspätet für ihr Debut „Blue Skies“ –, hatte sie als Autorin nie größere internationale Bekanntheit erreicht. Sechs Romane erschienen insgesamt von ihr – davon sind zwei ins Deutsche übersetzt –, bevor ihre bereits früh diagnostizierte Parkinson-Erkrankung sich so verschlechterte, dass sie ab 2001 nicht mehr schreiben konnte. Gut zwanzig Jahre später verstarb sie, mit 77 Jahren, in ihrer Heimat Tasmanien, wohin sie als Jugendliche nach einer Kindheit in England mit ihrer Familie ausgewandert war.
John von Düffel: Das Wenige und das Wesentliche.
Ein Stundenbuch anderer Art hat der Schriftsteller John von Düffel geschrieben – und ein viel beachtetes dazu. Dabei war ein über 200 Seiten laufendes Gedankengedicht sicher nicht etwas, wovon sich Düffels Stammverlag DuMont einen Verkaufsschlager erwartete – Lyrik ist ja angesichts der engen Nische, die sie bedient, ohnehin ein wenig das Schreckgespenst der Verlage. Doch John von Düffel, der seit dreißig Jahren nicht nur als gefragter Dramaturg, sondern auch als erfolgreicher Schriftsteller arbeitet, dessen Oeuvre Romane, Erzählungen, Essays und Theaterstücke umfasst, setzte sein Stundenbuch durch – heute, knapp zwei Jahre nach Erscheinen, liegt es in vierter Auflage vor.
„Das Wenige und das Wesentliche“ ist der Titel des in honiggelbem Leinen gefassten Buches. Und es geht, wie in den Ursprüngen der Gattung, um das richtige Leben. Oder nein: hier würde Düffel widersprechen: „Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Doch es gibt im Falschen eine richtige Richtung.“ Die Bescheidenheit ist in doppelter Weise Programm des Buches: an keiner Stelle glaubt sein Autor sich im Besitz der Wahrheit, nie kann oder will er uns Lesenden den einen gültigen Weg vorgeben. Aber er nimmt uns mit auf seinen durch Mythen, biblische Geschichten, Alltagsbeobachtungen, Naturbeschreibungen und Erinnerungen führenden Gedankengang, was im Buch seine ganz konkrete Entsprechung findet in einer Wanderung durchs ligurische Hinterland, angefangen zur fünften Stunde, beendet zur achtzehnten Stunde des Tages.
Philip Roth: Jedermann
"Jedermann“, 2006 erschienen, ist einer der letzten Romane von Philipp Roth, jenem amerikanischen Autoren, der 1969 mit Mitte dreißig durch seinen Roman „Portnoys Beschwerden“ unvermittelt ins Rampenlicht nicht nur Amerikas, sondern der literarischen Welt gestoßen wurde.
Überhaupt tragen die meisten Bücher von Philip Roth autobiographische Züge – so auch der Roman „Jedermann“. Er erzählt die Geschichte eines Lebens, wie es normaler nicht sein könnte – und das uns gerade darum in Bann zieht und berührt. Beginnend mit dem Tod des Protagonisten entfaltet sich dessen Vergangenheit – seine Arbeit als Designer in einer Werbeagentur, seine erste unglücklich verlaufende Ehe, der zwei ihm entfremdete Söhne entstammen, die Ehe mit der zweiten, der dritten Frau, die innige Beziehung zu Tochter Nancy, die ihm als einziges seiner Kinder nahesteht.
Er, der vieles falsch und einiges richtig gemacht hat, der liebte, begehrte, neidete und verzieh, und der sich schließlich in eine Einsamkeit manövriert hat, um deren Ursachen er selbst weiß, bleibt durch den ganzen Roman namenlos: er ist das allzu Menschliche par excellence. Und es ist der großen Kunst von Philip Roth geschuldet, dass uns diese Namenlosigkeit nicht auf Distanz hält, sondern im Gegenteil dem Protagonisten ganz nah kommen lässt.
Alice Munro: Ferne Verabredungen
Ich habe kein Talent zum Fan-Sein, aber wenn ich jemals ein Fan von jemandem sein würde, dann von Alice Munro. Sollten Sie sie noch nicht kennen: Sie haben wunderbare Entdeckungen vor sich! Sie werden eintauchen in die Lebensläufe von Frauen, irgendwo in Kanada, weit draußen auf dem Land und mitten in den Städten.
Sie werden ihnen bei ihren ersten Schritten in Richtung Emanzipation folgen, werden mit ihnen zurückblicken auf die Umbrüche in ihren Leben, auf die Männer, die Kinder, die Freundinnen, die sie hatten, Sie werden nach jeder der langen Kurzgeschichten, die so gehaltvoll wie kleine Romane sind, sie gleich nochmals lesen wollen, und Sie werden sich dabei die ganze Zeit fragen, wie Munro das macht: wie sie es hinbekommt, Sie so mitzunehmen in ihren Erzählkosmos, obwohl sie oft nur andeutet, Leerstellen lässt, wenig erklärt, nichts ausbuchstabiert.
Ich weiß nicht, wie oft ich meine Lieblingsgeschichte von ihr - „Der Bär kletterte über den Berg“ - gelesen habe, und immer noch ist mir nicht alles darin ganz klar geworden - es kann passieren, dass mir manchmal eine Überlegung dazu in den Kopf kommt, und dann lese ich sie nochmals und die Uneindeutigkeit bleibt, dabei geht es letztlich nur um eine lange Ehe, an deren Ende die Frau dement wird und sich so aus einer ebenso liebevollen wie unperfekten Beziehung löst.
Annette Mingels
Annette Mingels wurde 1971 in Köln geboren. Sie studierte Germanistik, Linguistik und Soziologie in Frankfurt, Köln, Bern und Fribourg und schloss mit einer Promotion in Germanistik ab.